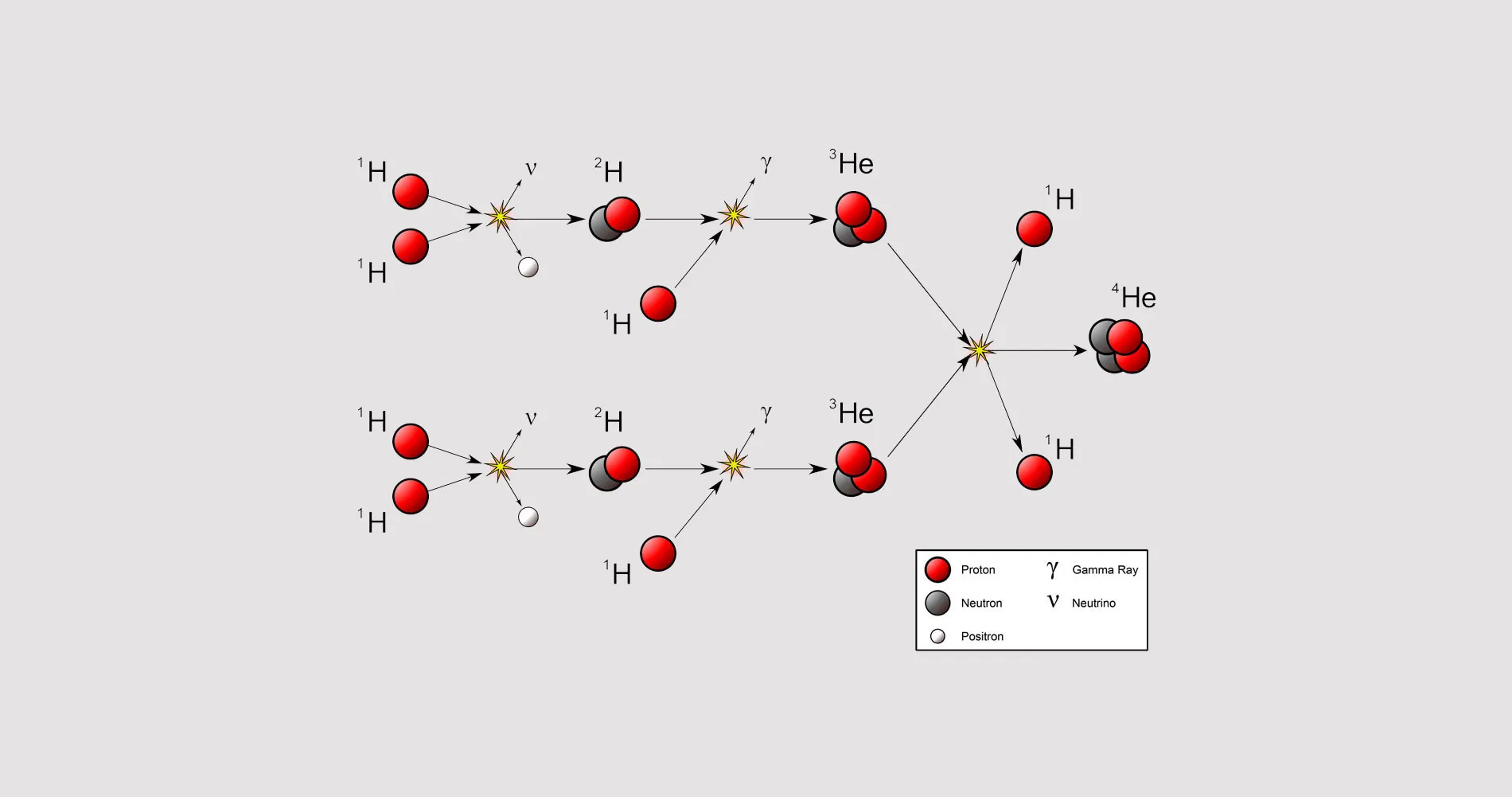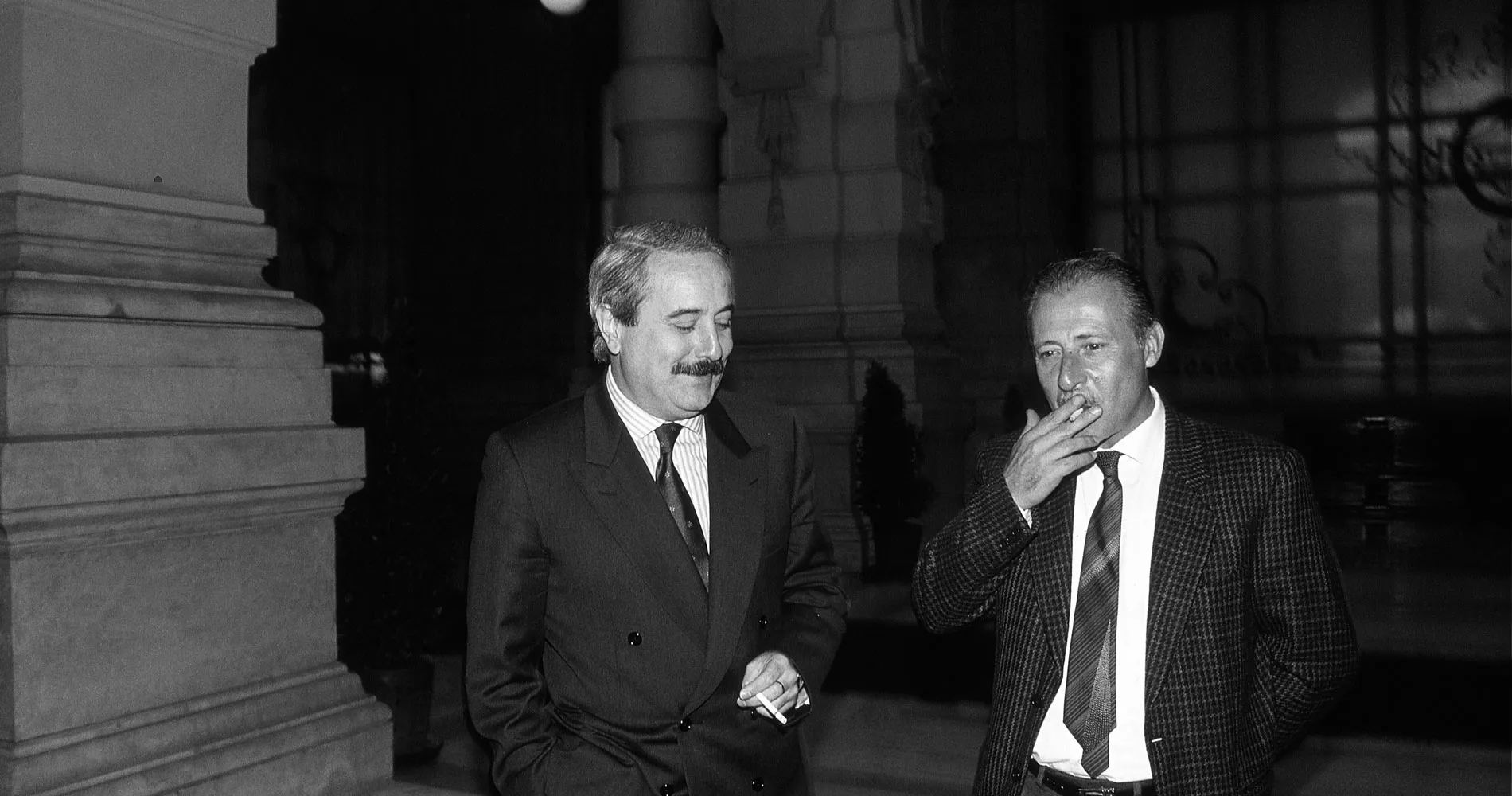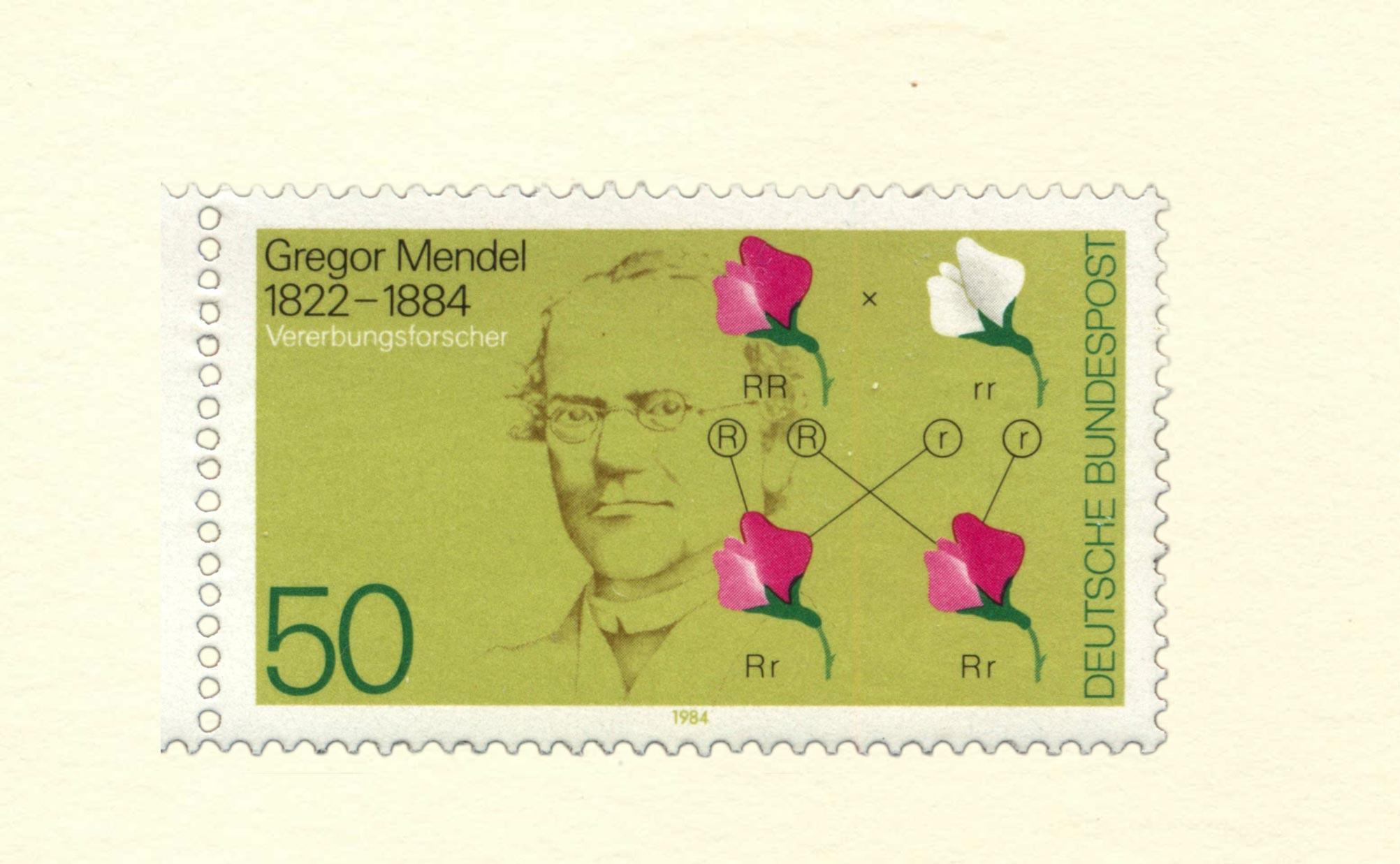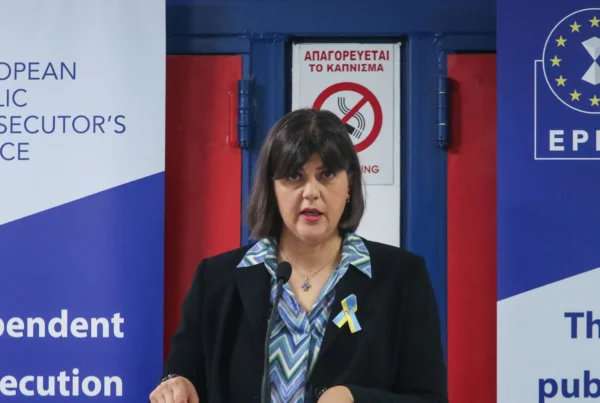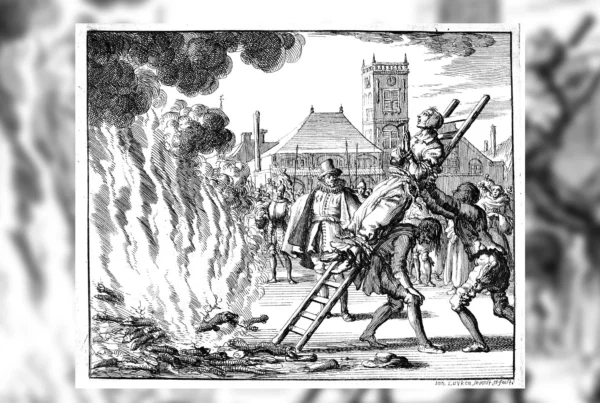Der 8. Oktober ist der Welttag des Oktopus. Ein guter Moment, um darüber nachzudenken, wie wir Menschen mit diesen intelligenten, fühlenden Lebewesen umgehen. Oktopusse jagen mit beeindruckender Präzision, geleitet von Seh- und Tastsinn, und ernähren sich von Krabben und Muscheln. Sie sind erfinderisch und nutzen Werkzeuge. Ihre Haut flackert in ständig wechselnden Farben und Strukturen – eine hochwirksame Tarnung, die ihnen hilft, Fressfeinden zu entkommen und zugleich eigene Beute zu täuschen. In ihrem kurzen Leben lernen sie, passen sich an und behalten Dinge im Gedächtnis. Die Oscar-prämierte Netflix-Dokumentation „My Octopus Teacher“ aus dem Jahr 2021 machte ihre Intelligenz und emotionale Tiefe einem großen Publikum bewusst. Genau diese Fähigkeiten stehen nun im Zentrum einer Grundsatzfrage: Sollte man derartige Wesen überhaupt züchten?
David Deegan
17 November 2025
English version | Spanish version
In Spanien hat ein Vorhaben, die weltweit erste Oktopusfarm im industriellen Maßstab zu errichten, eine globale Debatte ausgelöst. Das Fischereiunternehmen Nueva Pescanova plant, auf den Kanarischen Inseln jährlich bis zu eine Million Oktopusse zu züchten. Für die Befürworter ist das Projekt ein wissenschaftlicher Durchbruch und eine mögliche Rettung für eine angeschlagene Branche. Für andere hingegen ist es ein ethischer und ökologischer Irrweg – ein Schritt zu viel in dem menschlichen Drang, die Natur zu industrialisieren, selbst wenn es sich um fühlende, hochintelligente Tiere handelt.
Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Spaniens Wildfang von Oktopussen kurz vor dem Zusammenbruch steht. Einst ein nationales Kultgericht, wird der Oktopus vor den galicischen Küsten immer seltener; die Fangmengen sind stark eingebrochen, die Saison wurde verkürzt. Die Bestände entlang der spanischen Atlantikküste sind auf kalte, nährstoffreiche Auftriebsströmungen angewiesen – doch diese verlieren an Kraft, weil sich die Meere erwärmen. Veränderungen bei Strömungen und Sauerstoffgehalt stören Fortpflanzungszyklen und verringern das Nahrungsangebot.
Euronews berichtet, dass diese klimatischen Verschiebungen die galicische Fischerei bereits spürbar aus dem Gleichgewicht gebracht haben – zusätzlich zu den Folgen der Überfischung. Oktopus-Fischer erzählen, die Bestände würden „innerhalb von zwei Wochen zerstört“, sobald die Saison eröffnet ist. Weil die lokalen Vorkommen schrumpfen, importiert Spanien inzwischen den Großteil seines Oktopus aus Mauretanien und Marokko – ein Teufelskreis der Ausbeutung, der die Rufe nach alternativen Bezugsquellen lauter werden lässt.
Befürworter der Aquakultur argumentieren, die Zucht könne Märkte stabilisieren und Wildbestände schützen. Kritiker warnen jedoch, dass eher das Gegenteil eintreten könnte. Oktopusse sind Fleischfresser und würden enorme Mengen an Fischmehl benötigen, das wiederum aus Wildfisch gewonnen wird. Für jedes Kilo gezüchteten Oktopus müssten mehrere Kilo Wildfisch aus dem Meer entnommen werden – eine Ausbeutung der Meereswelt, die sich eher verstärkt als verringert. Wie Euronews anmerkte, könnte die Zucht eines Raubtiers zu einer „ökologischen Falle“ werden: Neue Angebote schaffen neue Nachfrage, statt Entlastung zu bringen.
Hinzu kommt: Als Karnivoren weit oben in der Nahrungskette reichern Oktopusse Schadstoffe wie Mikroplastik und Schwermetalle an, weil sie diese über ihre Beutetiere aufnehmen. Manche Haltungspraktiken – etwa das Entfernen der Eingeweide vor dem Verzehr – können das Risiko durch Schwermetalle verringern, doch für die direkte Entfernung von Mikroplastik gibt es bislang keine Methode.
Die Tierschutzbedenken reichen noch tiefer. Die Intelligenz von Oktopussen ist gut belegt. In Labortests öffnen sie Schraubgläser, finden sich in Labyrinthen zurecht und erkennen einzelne Menschen wieder. Auch in freier Wildbahn nutzen sie regelmäßig Werkzeuge – Steine, Muschelsplitter oder Glasscherben, die sie zu Schilden und Barrieren umfunktionieren. Die Netflix-Dokumentation „My Octopus Teacher“ hat dieses Verhalten eindrucksvoll festgehalten. Werkzeuggebrauch, ein Hinweis auf Lernfähigkeit, ist im Tierreich relativ selten und findet sich vor allem bei Primaten, Delfinen und einigen Vogelarten wie Krähen und Papageien. Nach Angaben des britischen Natural History Museum zählen unter den wirbellosen Tieren nur Oktopusse und wenige Insekten zu den bekannten Werkzeugnutzern.
Für Forschungszwecke gelten Oktopusse im EU-Recht als fühlende Wesen – fähig, Schmerz, Stress und möglicherweise sogar Emotionen zu erleben. Die Tierschutzorganisation World Animal Protection warnte im April 2025, dass die Haltung solcher einzelgängerischer, hochintelligenter Tiere in Becken unweigerlich chronisches Leid verursachen würde – mit hoher Wahrscheinlichkeit verbunden mit Aggressionen und Kannibalismus.
Zwar hat das Vereinigte Königreich 2021 ein Gesetz verabschiedet, das Krabben, Oktopusse und Hummer als fühlende Wesen anerkennt, doch änderte dieses Gesetz nichts an den bestehenden industriellen Praktiken – weder beim Fang noch in Restaurantküchen. Für Kopffüßer, die für Lebensmittel getötet werden, existieren keine anerkannten humanen Schlachtmethoden. Weder das Eintauchen in Eiswasser, noch das Zerschlagen des Kopfes oder das Durchtrennen des Gehirns gewährleistet ein sofortiges Ausschalten des Bewusstseins; nach gängigen Tierschutzstandards gelten all diese Verfahren als grausam. Für die Gegner industrieller Oktopuszucht ist dieser Widerspruch – Oktopusse als fühlende Wesen anzuerkennen, ihnen aber keinen Schutz zu gewähren – unhaltbar.
Im Mai 2025 legte INTERCIDS, der spanische Zusammenschluss von Juristinnen und Juristen im Tierschutzbereich, den nationalen Abgeordneten einen Gesetzesvorschlag vor: Spanien solle die Oktopuszucht vorsorglich verbieten, bevor sie überhaupt beginne. Ihr Argument beruht auf dem Vorsorgeprinzip – wenn die Risiken einer Tätigkeit unbekannt, aber potenziell gravierend sind, ist Vorbeugen klüger als Nachsorge. Spanien, Europas größter Oktopusverbraucher, könnte mit einem solchen Schritt ein starkes Zeichen setzen. Doch im Oktober 2025 teilte der Abogacía Española Consejo General, die Standesvertretung der spanischen Anwaltschaft, mit, dass der Vorschlag weiterhin geprüft werde.
Andernorts hat sich die Stimmung bereits gedreht. Der US-Bundesstaat Washington und Kalifornien haben die Oktopuszucht vollständig verboten, weitere Bundesstaaten erwägen ähnliche Gesetze. Im Kongress liegt zudem ein parteiübergreifender Gesetzentwurf vor, der sowohl die Zucht als auch den Import von gezüchtetem Oktopus untersagen soll. Für viele Befürworter eines Verbots ist die Entscheidung Spaniens entscheidend – ein Schritt, der entweder eine neue industrielle Grenze legitimieren oder eine klare Linie zum Schutz fühlender Meereswesen ziehen könnte.
Die Befürworter des Projekts halten dagegen, die Technologie könne durchaus nachhaltig sein. Nueva Pescanova verspricht, die Farmen würden „höchste Standards in Nachhaltigkeit und Tierwohl“ erfüllen. Unterstützer argumentieren zudem, Aquakultur könne den Druck auf die Wildbestände mindern und den Küstengemeinden wirtschaftliche Stabilität verschaffen.
Doch die Gegner bleiben skeptisch. Erfahrungen aus anderen Aquakulturen – Lachs, Garnelen, Thunfisch – zeigen, dass neues Angebot die Nachfrage meist eher anheizt, als den Wildfang zu ersetzen. Abwässer aus den Becken, Futterreste und Krankheitsausbrüche haben in der Vergangenheit immer wieder Umweltschäden verursacht. Bei Oktopussen, die als Einzelgänger und besonders empfindlich gelten, verschärfen sich die Tierschutzprobleme zusätzlich – zumal es bis heute keine erprobten Haltungsverfahren gibt, die als tiergerecht gelten könnten.
Die Befürworter eines Verbots sehen in der Debatte weit mehr als die Frage nach einer einzelnen Art. Aquakultur wurde einst als Ausweg aus der Überfischung gepriesen, reproduziert jedoch oft dieselbe ausbeuterische Logik – das industrielle Verwerten von Leben, um den menschlichen Appetit zu bedienen. Die Anlage von Garnelenfarmen zerstörte weite Mangrovengebiete, Lachszuchten belasteten Fjorde mit Abwässern, Chemikalien und Mikroplastik. Nun wird der Oktopus zum Prüfstein dafür, ob die Menschheit zur Zurückhaltung fähig ist.
Das spanische Parlament muss erst noch entscheiden, ob es die Oktopuszucht verbieten oder erlauben will. Die Folgen dieser Entscheidung werden weit über Spaniens Grenzen hinausreichen. Es geht dabei nicht nur um Meeresfrüchte oder Wissenschaft, sondern um Empathie, Neugier und Grenzen – um die Frage, ob alles, was intelligent oder schön ist, am Ende kommodifiziert – zu einer Ware – werden muss.
In den sich wandelnden Gewässern rund um Spanien, wo Überfischung, Erwärmung und menschlicher Ehrgeiz aufeinandertreffen, ist der Oktopus zu mehr geworden als nur zu sich selbst: zu einem Spiegel, den wir unserer eigenen Spezies vorhalten – mit der Frage, wie weit wir im Namen des „Fortschritts“ zu gehen bereit sind.