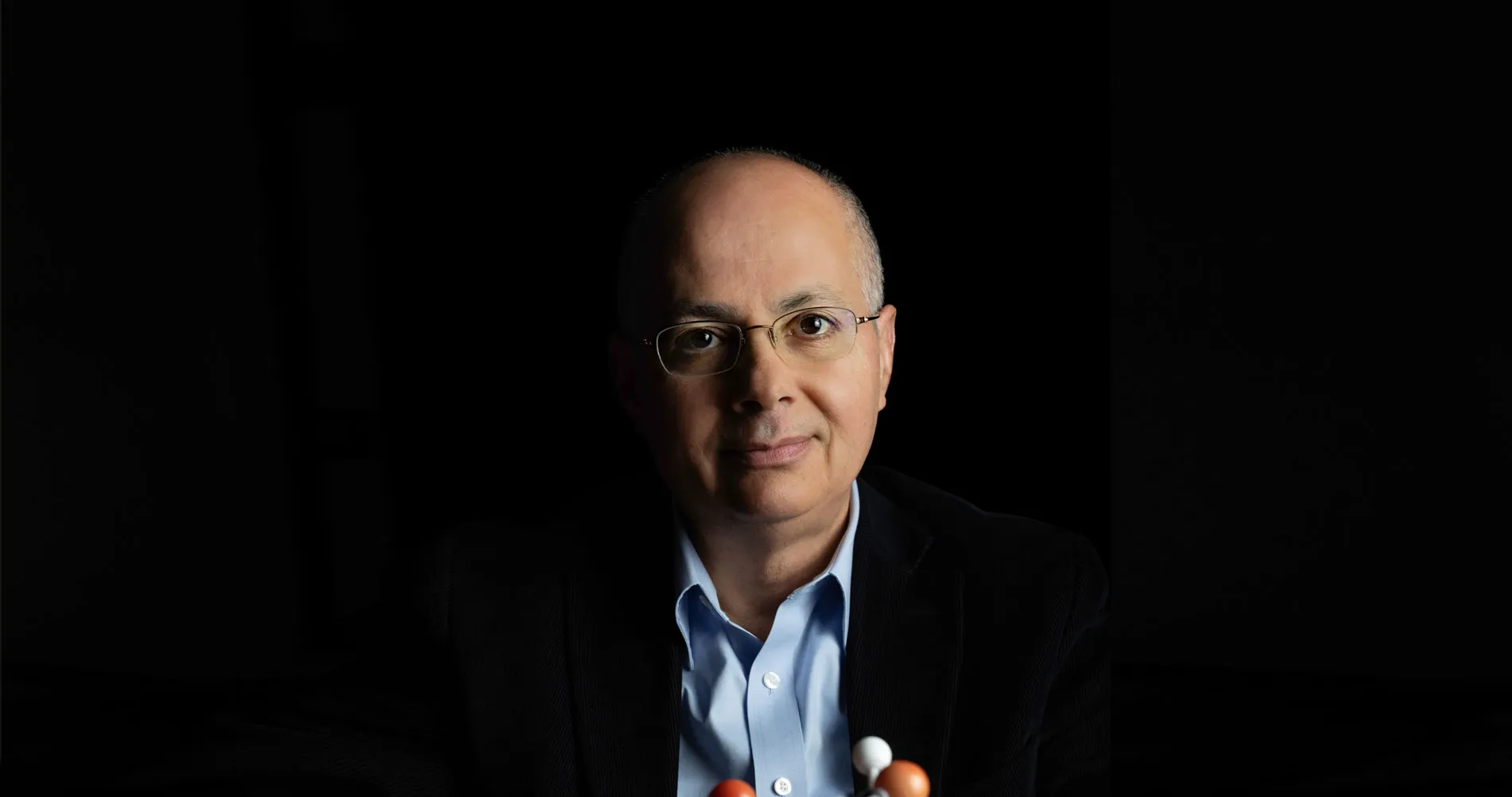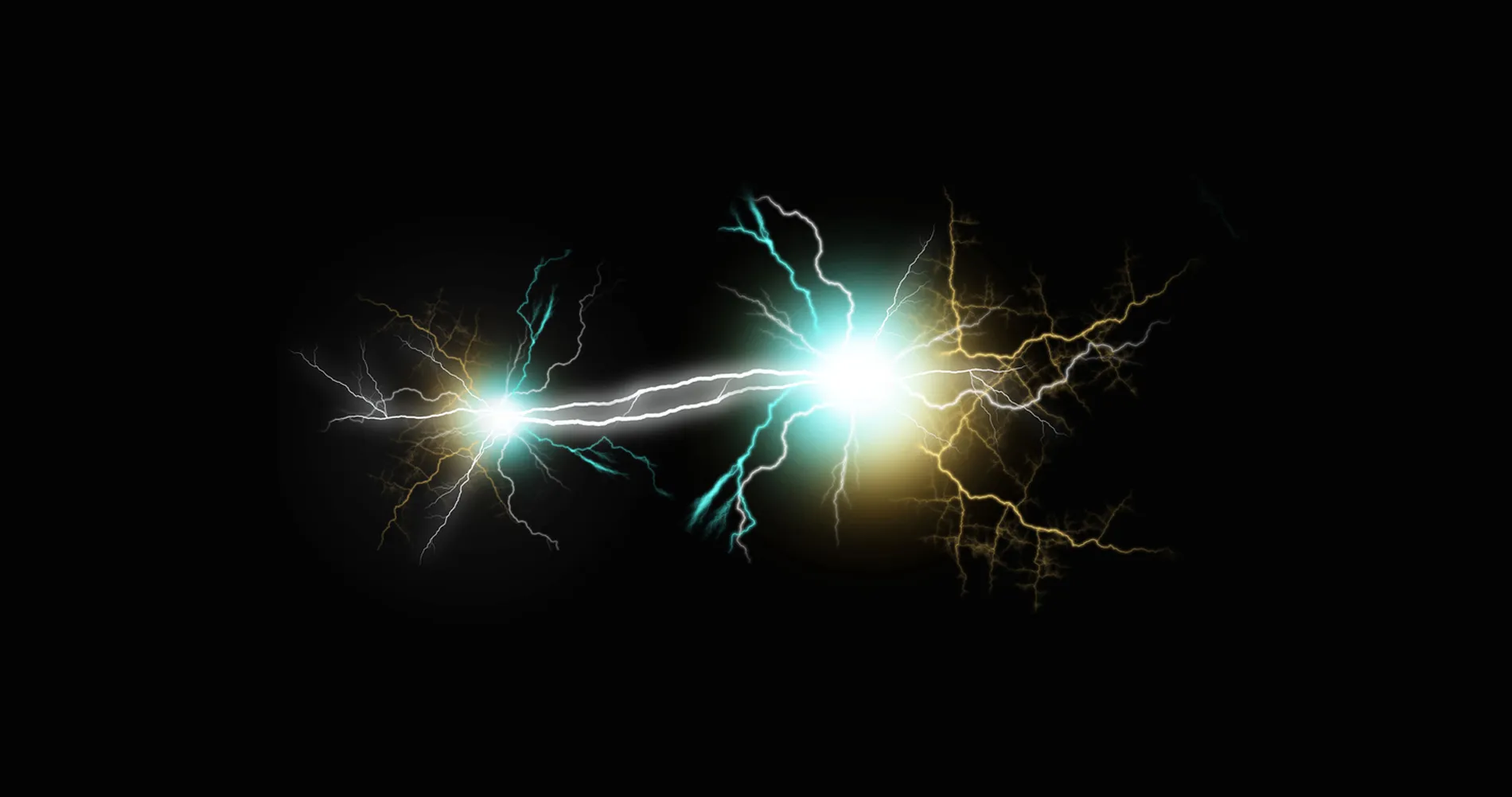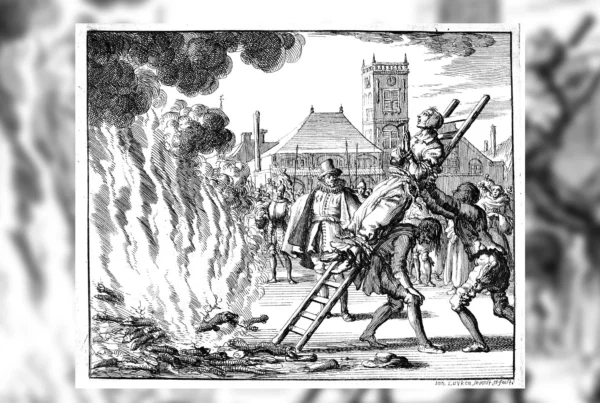Während China seine Position in Regionen stärkt, die traditionell den USA nahestehen, läuten in Washington die Alarmglocken – und Lateinamerika bildet dabei keine Ausnahme. Ein genauer Blick auf Pekings Engagement bei der OAS jedoch zeigt eine Strategie, die auf Soft Power und Diplomatie beruht. Doch was kostet Chinas Einflussnahme in Lateinamerika?
Jihane Karimou
12. Mai 2025
Chinese version | English version | Russian version
Chinas Ernennung zum ständigen Beobachter bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) im Jahr 2004 war ein strategischer Schritt, um seine diplomatische Präsenz in Lateinamerika auszuweiten. Zwar verleiht der Beobachterstatus keine Stimmrechte, doch verschafft er Peking eine wichtige Plattform: den Austausch mit regionalen Führungspersönlichkeiten, die Beteiligung an multilateralen Dialogen – und die Möglichkeit, schrittweise Einfluss auf politische Narrative in einem der zentralen multilateralen Foren der westlichen Hemisphäre zu nehmen.
Die OAS wurde 1948 gegründet und vereint 35 Staaten, die sich der Demokratie, den Menschenrechten und der regionalen Zusammenarbeit verpflichtet fühlen. Sie gilt als das zentrale multilaterale Forum der Region für politischen Dialog, Wahlbeobachtung, Konfliktlösung und gemeinsames Handeln zur Wahrung demokratischer Grundsätze. Traditionell wurde die Organisation von den Vereinigten Staaten geprägt. Doch mit Chinas wachsender Bedeutung als wirtschaftlicher und diplomatischer Partner beginnt sich das Machtgefüge innerhalb der OAS allmählich zu verschieben.
Chinas Engagement ist Teil einer umfassenderen Strategie, die Beziehungen zu lateinamerikanischen Staaten durch wirtschaftliche und diplomatische Initiativen zu vertiefen. Dazu zählt auch die Belt and Road Initiative (BRI), mit der sich China Zugang zu wichtigen Minen, Rohstoffen, Häfen und Infrastrukturprojekten in der Region sichert. Der Beobachterstatus bei der OAS ergänzt dieses Vorgehen und stärkt Pekings Einfluss durch Soft Power. Vize-Außenminister Xie Feng beschreibt dieses Bestreben als den Versuch, eine Welt zu gestalten, die auf „gegenseitiger Unterstützung“ und einer „multipolaren Ordnung“ basiert.
Während manche befürchten, China wolle die OAS unter seine Kontrolle bringen, sehen viele lateinamerikanische Staaten Chinas Rolle vielmehr als willkommenen Ausgleich zum Einfluss der USA und des Westens. Peking positioniert sich gezielt als kooperativer Partner für die Länder der Region.
Die US-Politik unter Präsident Donald Trump könnte diesen Kurswechsel hin zu China weiter beschleunigen. Am 26. Januar 2025 kam es zu einer diplomatischen Krise, als der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sich weigerte, Abschiebeflüge aus den USA zu akzeptieren. Als Reaktion drohte Präsident Trump mit Strafzöllen von 50 % auf kolumbianische Importe. Zwar wurde die Krise letztlich entschärft, doch machte sie deutlich, welchen neuen, konfrontativeren Kurs die US-Regierung verfolgt – ein deutlicher Bruch mit der Linie der vorherigen Biden-Administration.
Solche Vorfälle verdeutlichen, warum viele Länder zunehmend offen für Chinas Modell der vermeintlichen Nichteinmischung sind. Präsident Xie zufolge sollten sich Entwicklungsländer nicht länger mit einer Rolle am „unteren Ende der globalen Industrieketten“ zufriedengeben und sich gegen Unterdrückung im Namen von „Demokratie“ und „Menschenrechten“ zur Wehr setzen. Diese Botschaft findet Anklang bei Staaten, die nach neuen Wegen für ihre Entwicklung suchen – und nach größerer Unabhängigkeit von den USA. Doch diese Unabhängigkeit hat ihren Preis: die Gefahr von US-Sanktionen und sogenannten Sekundärsanktionen.
Chinas Strategie beschränkt sich keineswegs auf Lateinamerika. Ähnliche Ansätze verfolgt das Land auch in Afrika, Südostasien und der Karibik – etwa durch den Beitritt zu regionalen Organisationen wie der Afrikanischen Union oder CARICOM und durch die Finanzierung multilateraler Initiativen. All diese Maßnahmen stärken Chinas weltweite Präsenz und verleihen seinem internationalen Auftreten mehr Legitimität – zugleich inszeniert sich Peking als Partner einer solidarischen Süd-Süd-Zusammenarbeit.
Gleichzeitig bemühen sich viele lateinamerikanische Regierungen aktiv darum, ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Optionen zu diversifizieren. Länder wie Brasilien, Argentinien und Mexiko zeigen ein wachsendes Interesse am Multilateralismus und versuchen, ihre Beziehungen sowohl zu China als auch zu den USA ausgewogen zu gestalten, statt sich eindeutig auf eine Seite zu schlagen. Für diese Staaten bietet Chinas Modell – staatlich gelenkte Investitionen, Infrastrukturprojekte und ein geringes Maß an politischer Einmischung – greifbare Vorteile. Doch Chinas Engagement ist nicht bedingungslos: Es weckt auch Bedenken hinsichtlich langfristiger Verschuldung, des Verlusts von Autonomie und der Einhaltung von Umweltstandards.
Die Vereinigten Staaten sehen sich unterdessen wachsenden Herausforderungen gegenüber, ihre Führungsrolle innerhalb der OAS aufrechtzuerhalten. Zwar treten sie weiterhin für demokratische Werte ein, doch ihre Glaubwürdigkeit leidet unter inkonstantem Engagement und einer langen Geschichte einseitiger Entscheidungen. Die Biden-Regierung versuchte zwar, mit Initiativen wie der Americas Partnership for Economic Prosperity (APEP) die Region wieder stärker einzubinden, doch Kritiker bemängeln, diese Maßnahmen seien zu zaghaft und kämen nur schleppend voran. Sollte Washington nicht deutlich stärker in regionale Diplomatie und Entwicklung investieren, droht seine Rolle weiter an Bedeutung zu verlieren.
Durch seinen Beobachterstatus gewinnt China an Sichtbarkeit, baut Vertrauen auf und weitet seinen Einfluss aus – und das ohne den konfrontativen Ton, der jüngere US-Politiken zunehmend prägt.
Auch wenn China innerhalb der OAS keine formale Macht besitzt, deutet seine Beteiligung auf eine weitreichendere Neuausrichtung hin. Indem Peking sich in das führende diplomatische Gremium der Region einbringt, Entwicklungsziele unterstützt und sein Modell pragmatischer internationaler Zusammenarbeit präsentiert, trägt es aktiv dazu bei, das außenpolitische Gefüge Lateinamerikas neu zu gestalten.
Während globale Mächte weiterhin um die Gunst der Region werben, bleibt die zentrale Frage bestehen: Wird Lateinamerika seine strategische Bedeutung nutzen, um eine eigene Agenda zu verfolgen – oder gerät es zunehmend zum Schauplatz externer Einflussnahme?